Zur Vertiefung: Muscheler JURA 2009, 329 ff. und 567 ff.
Begriff
Der Erbschein ist ein vom Amtsgericht als Nachlassgericht auf Antrag ausgestelltes Zeugnis über das Erbrecht (§ 2353 BGB). Der Erbschein genießt öffentlichen Glauben und schützt das Vertrauen desjenigen, der im Vertrauen auf die Richtigkeit des Erbscheins vom sog. Scheinerben erwirbt (§ 2366 BGB), d.h. von jemandem, der im Erbschein als Erbe ausgewiesen ist, ohne dass ihm in Wahrheit das ausgewiesene Erbrecht zustünde.
Der Erbschein ist öffentliche Urkunde i. S. des § 415 Abs. 1 ZPO und seine Echtheit wird unter den Voraussetzungen des § 437 Abs. 1 ZPO vermutet.
Der Erbe ist zwar nicht verpflichtet, einen Erbschein zu beantragen. Vielfach wird im Rechtsverkehr aber zum Nachweis des Erbrechts ein Erbschein verlangt.
Beispiel: Als Erblasserin E verstirbt, möchte ihre Tochter das Aktiendepot auflösen. Bei der Bank verlangt man die Vorlage eines Erbscheins. Zu Recht? Nach Auffassung der Rspr. besteht grundsätzlich kein Leistungsverweigerungsrecht bis zur Vorlage eines Erbscheins durch den Erben. Die Bank muss insbesondere auch einen sonstigen Nachweis des Erbrechts anerkennen. Dies gilt sowohl für ein öffentliches Testament (BGHZ 198, 250 ff.) als auch für ein „eröffnetes“ (dazu § 2259 Abs. 1 BGB, § 348 Abs. 1 S. 2 FamFG) eigenhändiges Testament (BGHZ 209, 329, 333 f.). Eine Bank, die gleichwohl auf der Vorlage eines Erbscheins besteht, kann sich schadensersatzpflichtig machen, wenn die Erbfolge mit der „hinreichenden Eindeutigkeit“ aus dem Testament nachweisbar ist (Frage des Einzelfalles). Daraus kann sich u.a. eine Verpflichtung zum Ersatz der für die Beantragung des Erbscheins verauslagten Gerichtskosten ergeben (§ 280 Abs. 1 BGB).
Der Erbschein erfüllt drei Funktionen: Legitimierungsfunktion (etwa gegenüber dem Grundbuchamt, § 35 Abs. 1 GBO), Beweisfunktion (§ 2365 BGB) und Gutglaubensfunktion (§§ 2366, 2367 BGB).
Inhalt
Der Erbschein weist das Erbrecht, die Erbteilsgröße (§ 2353 BGB) und die Verfügungsbeschränkungen des Erben infolge Anordnung von Testamentsvollstreckung und/oder Nacherbschaft (dazu auch § 2363 BGB) aus. Sonstige Angaben, etwa über das Bestehen von Pflichtteilsansprüchen, Auflagen oder Vermächtnissen oder tatsächliche Angaben über den Nachlass dürfen nicht aufgenommen werden, machen den Erbschein aber nicht unwirksam (Röthel ErbR § 30 Rn. 3).
Beachte: Der Erbschein hat nur deklaratorische, keine konstitutive Wirkung. Die Erbenstellung wird nicht begründet, sondern lediglich bezeugt. Wird im Erbschein „A“ als Erbe ausgewiesen, wird „A“ allein dadurch nicht Erbe! Vielmehr gilt: Man kann Erbe sein und bleiben, ohne einen Erbschein zu haben oder zu erlangen.
Dem Alleinerben kann ein Alleinerbschein ausgestellt werden (§ 2353 Alt. 1 BGB), einem von mehreren Miterben ein Teilerbschein, der die Größe des Erbteils durch Nennung einer Erbquote (§ 2353 Alt. 2 BGB) bezeugt (Erblasser E wird von A zu ½ beerbt). Ein Miterbe kann aber auch die Erteilung eines gemeinschaftlichen Erbscheins beantragen (§ 352a Abs. 1 S. 1 FamFG). Im Unterschied zum Teilerbschein weist der gemeinschaftliche Erbschein alle Erben und ihre Erbteile aus: „Erblasser E wird von A, B und C zu je 1/3 beerbt“.
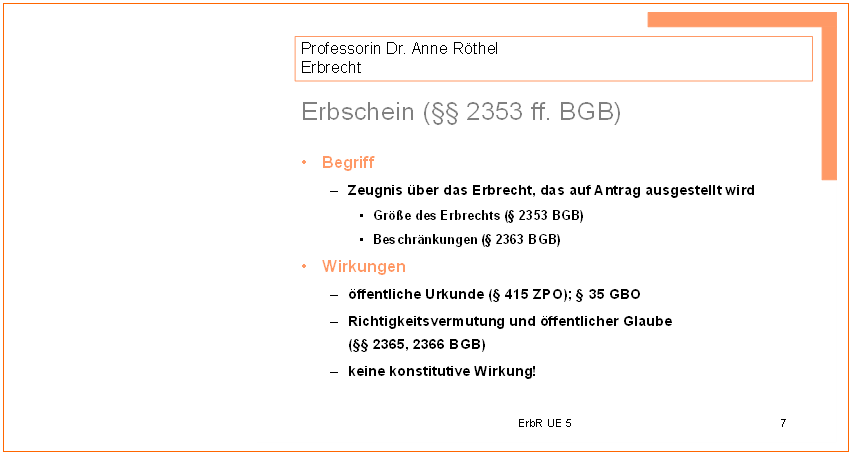
Rechtswirkungen
Der Erbschein begründet die Vermutung der Richtigkeit (§ 2365 BGB) und genießt öffentlichen Glauben, d.h. er schützt gutgläubige Dritte bei Verfügungsgeschäften mit dem als Erben Ausgewiesenen (§§ 2366, 2367 BGB).
Die Wirkungen des Erbscheins (§§ 2365−2367 BGB) sind denen des Grundbuchs (§§ 891 ff. BGB) vergleichbar.
Die Rechtswirkungen des Erbscheins beginnen mit der Erteilung des Erbscheins durch das Nachlassgericht. Sie enden, wenn das Nachlassgericht den Erbschein „einzieht“ (§ 2361 S. 2 BGB) oder ihn für kraftlos erklärt (§ 353 Abs. 1 FamFG).
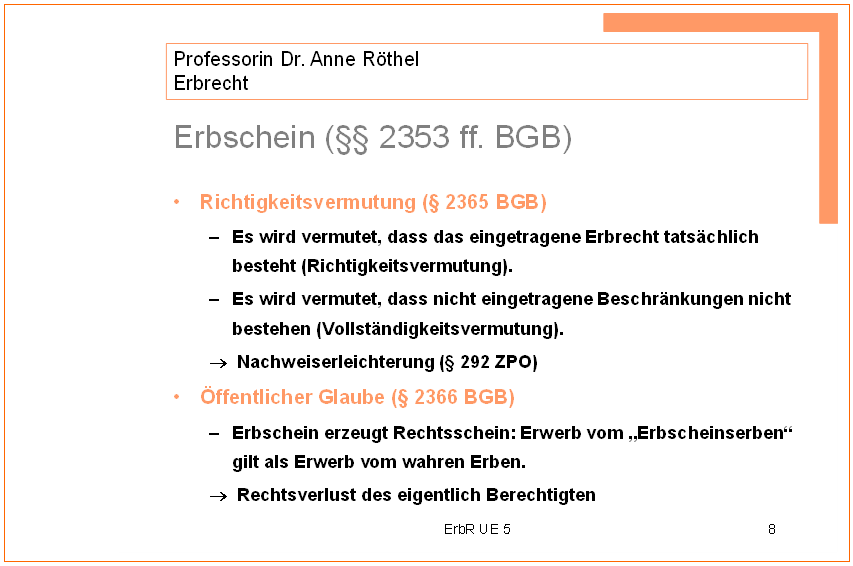
Richtigkeitsvermutung (§ 2365 BGB)
Es wird vermutet, dass dem im Erbschein bezeichneten Erben (Erbscheinserben) das angegebene Erbrecht zusteht (Richtigkeitsvermutung) und er nicht durch andere als die im Erbschein aufgeführten Anordnungen beschränkt ist (Vollständigkeitsvermutung).
§ 2365 BGB ähnelt § 891 Abs. 1 BGB. Dort wird vermutet, dass ein im Grundbuch eingetragenes Recht so, wie es eingetragen ist, auch tatsächlich besteht. Aus § 892 BGB ergibt sich, dass auch die Richtigkeit nicht eingetragener Beschränkungen vermutet wird.
Es handelt sich um eine mit allen Beweismitteln widerlegbare Rechtsvermutung (§ 292 ZPO). Gelingt der Beweis der Unrichtigkeit des Erbscheins nicht, hat das Gericht von der im Erbschein dokumentierten Erbfolge auszugehen. Die Vermutung bezieht sich nur auf das in § 2365 BGB Genannte, also die Erbenstellung und die Größe des Erbrechts (Quote) sowie das Nichtbestehen nicht eingetragener Beschränkungen.
Abgrenzung: § 2365 BGB betrifft weder die Zugehörigkeit von Gegenständen zum Nachlass noch das Eigentum des Erblassers oder die Freiheit von anderen Belastungen (Vermächtnisse, Auflagen, Auseinandersetzungsanordnungen, Pflichtteile).
Öffentlicher Glaube (§ 2366 BGB)
Öffentlicher Glaube (§ 2366 BGB) ist mehr als Richtigkeitsvermutung (§ 2365 BGB): Bei der Richtigkeitsvermutung geht es um eine Verteilung der Darlegungs- und Beweislast. Öffentlicher Glaube bedeutet hingegen, dass der Erbschein einen Rechtsschein erzeugt, der z.B. einen redlichen Erwerb vom eigentlich Nichtberechtigten ermöglicht.
Seiner Funktion nach entspricht § 2366 BGB in etwa § 892 Abs. 1 S. 1 BGB!
Anders als bei § 891 Abs. 1 BGB erstreckt sich der öffentliche Glaube des Erbscheins gemäß §§ 2366, 2367 BGB auf jede Form des rechtsgeschäftlichen Erwerbs von Erbschaftsgegenständen: §§ 2366, 2367 BGB gelten also nicht nur für Verfügungen über Sachen, sondern auch für Verfügungen über Forderungen.
§ 2366 BGB
Klausurhinweis: § 2366 BGB ist weder eine Anspruchsgrundlage noch ein Erwerbstatbestand. Die Vorschrift ist vielmehr inzident im Rahmen von §§ 398, 929 ff., 873 BGB zu prüfen.
Rechtsgeschäftliches Erwerbsgeschäft über einen Erbschaftsgegenstand
§ 2366 BGB ist anwendbar auf rechtsgeschäftliche Erwerbsgeschäfte über Erbschaftsgegenstände, d.h. über Sachen und Rechte jeder Art (Forderungen, Urheber-, Patentrechte etc.). Nicht anwendbar ist § 2366 BGB – genauso wie die §§ 932 ff., 891 BGB –, wenn es um einen gesetzlichen Erwerb geht oder wenn der Erwerb kein Verkehrsgeschäft darstellt.
Ein Verkehrsgeschäft liegt nicht vor bei Rechtsgeschäften innerhalb der Erbengemeinschaft; näher BGH NJW 2015, 1881 = JURA (JK) 2015, 1257 (Röthel).
Weiter ist erforderlich, dass es sich um einen Erbschaftsgegenstand handelt (§ 2366 BGB). Gemeint ist, dass der Erwerber nur dann in den Genuss des öffentlichen Glaubens des Erbscheins kommen soll, wenn er wusste, dass er einen Gegenstand aus einem Nachlass erwirbt (Brox/Walker ErbR § 35 Rn. 8b; Michalski/Schmidt ErbR § 25 Rn. 1300). Gehört der Gegenstand in Wahrheit nicht zum Nachlass (dazu noch unten, cc [2]), soll es genügen, dass der Gegenstand „als“ Nachlassgegenstand erworben wird.
Keine Kenntnis von der Unrichtigkeit des Erbscheins oder vom Rückgabeverlangen des Nachlassgerichts
In subjektiver Hinsicht schadet positive Kenntnis von der Unrichtigkeit des Erbscheins (wie bei § 892 Abs. 1 BGB, anders § 932 Abs. 2 BGB) oder davon, dass das Nachlassgericht die Rückgabe des Erbscheins verlangt hat.
Vertiefungsfrage: Was gilt, wenn der Erwerber lediglich wusste, dass das Nachlassgericht den Erbschein eingezogen hat?
Dann kommt es auf § 2366 BGB gar nicht mehr an, weil der Erbschein mit seiner Einziehung „kraftlos“ geworden ist, also seinen öffentlichen Glauben verloren hat (§ 2361 Abs. 1 S. 2 BGB).
Der Kenntnis von der Unrichtigkeit des Erbscheins gleichgestellt ist die Kenntnis der Anfechtbarkeit der dem Rechtsschein zugrunde liegenden letztwilligen Verfügung (§ 142 Abs. 2 BGB).
Beachte: Nicht erforderlich ist, dass der Erwerber den Erbschein überhaupt eingesehen hat; er muss noch nicht einmal wissen, dass ein Erbschein überhaupt erteilt wurde. Genauso wie bei § 892 BGB geht es um den Schutz abstrakten Vertrauens.
Es schadet Kenntniserlangung bis zur Vollendung des Rechtserwerbs. Eine Vorverlegung des hiernach maßgeblichen Zeitpunkts wie in § 892 Abs. 2 BGB ist in § 2366 BGB nicht vorgesehen. Auch eine analoge Anwendung des § 892 Abs. 2 BGB auf § 2366 BGB wird abgelehnt, wenn es um den Erwerb eines Rechts geht, der eine Eintragung voraussetzt (§ 873 Abs. 1 BGB): Zum Erwerb von Grundstücksrechten muss der Erwerber also grundsätzlich bis zur Eintragung des Rechts gutgläubig sein.
Achtung: Umstritten ist, ob dies auch gilt, wenn das zu erwerbende Recht durch eine Vormerkung gesichert ist. Nach einer Auffassung soll es auch in diesem Fall beim Zeitpunkt der Eintragung (≠ Stellung des Antrags, wie bei § 892 Abs. 2 BGB!) der Vormerkung bleiben (MünchKommBGB/Grziwotz § 2366 Rn. 17). Der BGH hat anders entschieden: Wegen der Sicherungsfunktion der Vormerkung soll es hier ausnahmsweise auf den Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Eintragung der Vormerkung ankommen (BGHZ 57, 341, 343).
Beispiel: Erblasserin E ist eingetragene Eigentümerin eines Grundstücks. Als sie verstirbt, ist ein Testament nicht aufzufinden. Das Nachlassgericht erteilt ihrer Tochter T auf deren Antrag einen Erbschein, der sie als Alleinerbin ausweist. Ohne selbst voreingetragen zu sein, veräußert T das Grundstück unter Vorlage des Erbscheins (§§ 40 Abs. 1, 39 Abs. 1 GBO) an die K, die im Grundbuch als neue Eigentümerin eingetragen wird. Kurze Zeit später findet die Lebensgefährtin L das Testament der E, in dem sie zur Alleinerbin eingesetzt ist. L beantragt daraufhin beim Nachlassgericht einen neuen Erbschein, der sie als Alleinerbin ausweist. Der der T erteilte Erbschein wird eingezogen. L fordert K auf, ihre Zustimmung zur Grundbuchberichtigung zu erteilen. Zu Recht?
Anspruch der L gegen K auf Zustimmung zur Grundbuchberichtigung gemäß § 894 BGB, wenn der Grundbuchinhalt von der wahren Rechtslage abweicht. Dies ist der Fall, wenn K nicht Eigentümerin des Grundstücks geworden ist. Eigentumserwerb an dem Grundstück gemäß §§ 873 Abs. 1, 925 BGB? Einigung (+), Eintragung der K ist ebenfalls erfolgt (auch ohne Voreintragung der T möglich; §§ 39, 40 GBO), Berechtigung der T (-), weil nicht T, sondern L mit dem Erbfall Eigentümerin (§ 1922 BGB) des Grundstücks geworden ist. Der erteilte Erbschein hat als solcher keine Auswirkungen auf die materielle Rechtslage. Überwindung des Mangels der Berechtigung gemäß § 892 Abs. 1 BGB (-), weil T nicht eingetragen ist. Aber: Überwindung des Mangels der Berechtigung gemäß § 2366 BGB (+), d.h. die gutgläubige K wird so behandelt, als hätte sie von der wahren Erbin L erworben [dann kommt es auf § 892 BGB gar nicht an, weil K von der Berechtigten erwirbt]. § 894 BGB daher (-).
Zusammenfassung:
Bei § 2366 BGB schadet positive Kenntnis von der Unrichtigkeit des Erbscheins oder Wissen, dass das Nachlassgericht die Einziehung des Erbscheins verlangt hat; bei § 892 Abs. 1 BGB positive Kenntnis von der Unrichtigkeit des Grundbuchs.
Bei § 2366 BGB ist stets der Zeitpunkt der Vollendung des Rechtserwerbs maßgeblich; bei § 892 Abs. 2 BGB kommt es auf den Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Eintragung an.
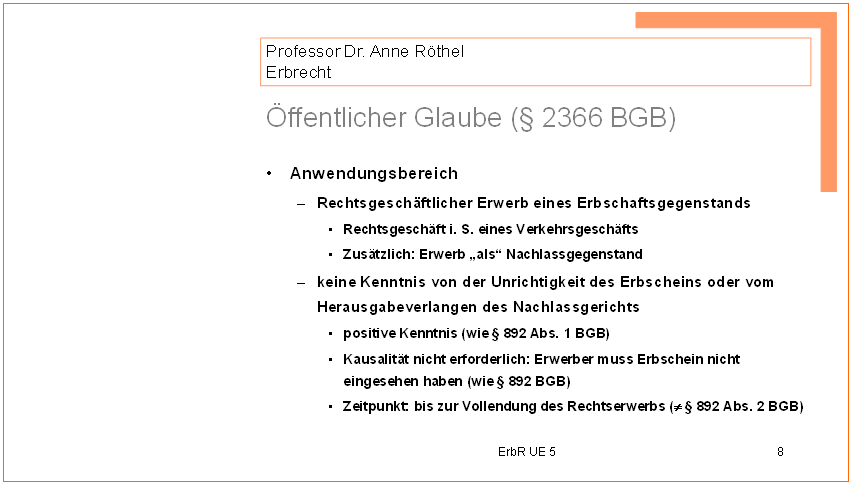
Wirkungen
Der im Erbschein ausgewiesene Erbe gilt für den rechtsgeschäftlichen Erwerb eines Nachlassgegenstands als wahrer Erbe. Der Erwerber erwirbt so, als wäre der Scheinerbe wahrer Erbe.
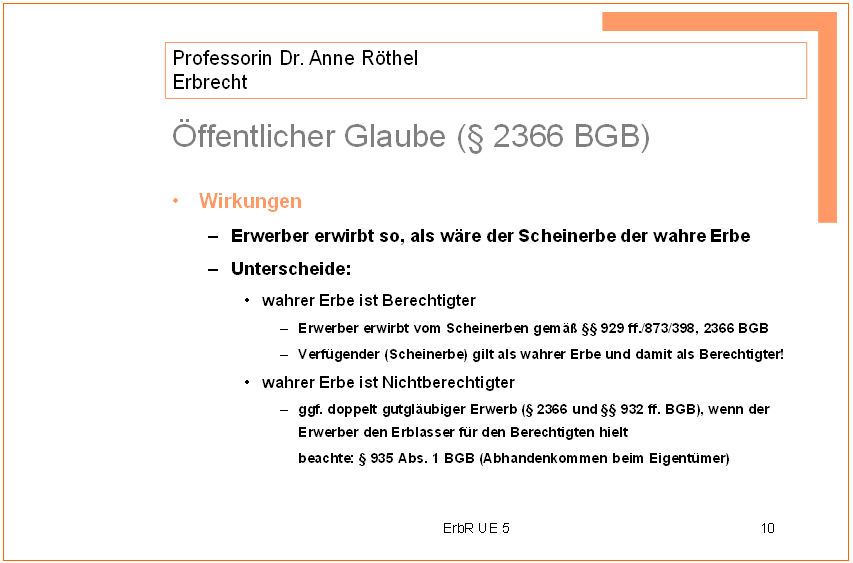
Wahrer Erbe ist Berechtigter
Ist der wahre Erbe Berechtigter (= verfügungsbefugter Rechtsinhaber), so erwirbt der Erwerber den Nachlassgegenstand gemäß § 2366 BGB in Verbindung mit §§ 398, 929 ff., 873 ff. BGB etc. durch Verfügung des Scheinerben (= Nichtberechtigten).
Beispiel: Als Erblasserin E verstirbt, hinterlässt sie ihre Tochter T als Alleinerbin. Im Erbschein wird aufgrund eines zunächst für wirksam gehaltenen Testaments ihre Cousine C als Alleinerbin ausgewiesen. C veräußert einen Teppich, der zum Nachlass gehört, an die gutgläubige Händlerin H. Wer ist Eigentümerin des Teppichs?
Ursprünglich war E Eigentümerin des Teppichs. Mit ihrem Tod ist das Eigentum an dem Teppich (und den weiteren Nachlassgegenständen) auf die Alleinerbin T übergegangen (§ 1922 Abs. 1 BGB). T könnte ihr Eigentum durch Verfügung der C an H gemäß § 929 S. 1 BGB verloren haben. Einigung, Übergabe, Einigsein (+), aber Berechtigung (-), weil C in Wahrheit nicht Erbin und daher nicht Gesamtrechtsnachfolgerin (§ 1922 Abs. 1 BGB) und daher nicht Berechtigte war.
Überwindung des Mangels der Berechtigung gemäß § 932 Abs. 1 S. 1 BGB? Rechtsgeschäft i. S. eines Verkehrsgeschäfts, Rechtsschein der Berechtigung zugunsten des Veräußerers (+), Erwerber nicht bösgläubig (+). Aber: Unfreiwilliger Besitzverlust der wahren Eigentümerin (T), als C den Teppich an sich genommen hat (= Verlust des unmittelbaren Erbenbesitzes, §§ 857, 854 Abs. 1 S. 1 BGB). Daher steht § 935 Abs. 1 BGB einem Eigentumserwerb der H entgegen.
Aber: Überwindung des Mangels der Berechtigung gemäß § 2366 BGB? Rechtsgeschäftlicher Erwerb eines Gegenstands als Nachlassgegenstand (+), Veräußerer ist im Erbschein als Erbe ausgewiesen (+), keine Kenntnis von der Unrichtigkeit des Erbscheins oder von einem Rückgabeverlangen des Nachlassgerichts (+). Daher: Die Verfügung der C gilt als Verfügung der T [der Erwerber erwirbt durch Rechtsgeschäft mit dem Scheinerben so, als erwerbe er vom wahren Erben], so dass H gemäß §§ 929 S. 1, 2366 BGB Eigentum an dem Teppich erworben hat.
Aus dem vorstehenden Beispiel ergibt sich zugleich, dass § 2366 BGB keinen Ausschlussgrund vergleichbar zu § 935 Abs. 1 BGB kennt: Auch an abhanden gekommenen Sachen kann vom Scheinerben redlich Eigentum erworben werden. Der Schutz des § 857 BGB zugunsten des wahren Erben wird also durch § 2366 BGB wieder eingeschränkt.
Wahrer Erbe ist Nichtberechtigter
§ 2366 BGB führt allerdings nur dazu, dass der verfügende Scheinerbe einem wahren Erben gleichgestellt wird. Gehört ein Gegenstand in Wahrheit gar nicht zum Nachlass, ist also auch der wahre Erbe Nichtberechtigter, so kann § 2366 BGB allein keinen Erwerb begründen. Denkbar ist dann eher umgekehrt, dass sich der Erwerb allein über § 932 Abs. 1 S. 1 BGB erklären lässt:
Beispiel: Die B hat der L eine Vase geliehen. Als L verstirbt, wird ein Erbschein zugunsten ihrer Ehefrau E ausgestellt. E nimmt die Vase an sich und schenkt sie nun ihrer Nachbarin N, die die L schon zu deren Lebzeiten gebeten hatte, ihr die Vase eines Tages zu überlassen, nachdem L sie ihr stolz präsentiert hatte. Nun stellt sich heraus, dass L ein Testament zugunsten ihrer Schwester S errichtet hatte. Als B von allem erfährt, verlangt sie von N Herausgabe der Vase. Zu Recht?
§ 985 BGB? Dazu müsste B noch Eigentümerin sein. Verlust an L (-), keine Einigung. Verlust an E ebenfalls (-). Verlust an N durch Verfügung der E?
1. gemäß §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1 BGB? Einigung, Übergabe, Einigsein (+), Berechtigung (-), denn E ist nicht Eigentümerin der Vase; Überwindung des Mangels der Berechtigung gemäß § 932 Abs. 1 S. 1 BGB? § 935 Abs. 1 S. 1 BGB steht nicht entgegen, da Eigentümerin B den Besitz willentlich an L aufgegeben hat. Aber § 935 Abs. 1 S. 2 BGB steht entgegen. Danach liegt Abhandenkommen auch vor, wenn die Sache dem Besitzmittler abhanden gekommen ist. Dies war hier zunächst L. Mit dem Tod der L ist der unmittelbare Fremdbesitz auf die wahre Erbin S übergegangen (§ 857 BGB; mit § 857 BGB geht auch die Besitzrichtung mit über, hier also die Qualifikation als Fremdbesitz, siehe Staudinger/Gutzeit § 857 Rn. 13). Diesen Fremdbesitz hat sie gegen ihren Willen verloren, als E die Vase der N aushändigte [a.A. vertretbar, etwa mit dem Argument, dass § 857 BGB den Erben schützen soll, nicht aber einen vom Erben verschiedenen Eigentümer. Auch bezweckt § 935 Abs. 1 BGB den Schutz des Eigentümers vor einem unfreiwilligen Verlust der Besitzposition. Wo eine solche aber „real“ nicht mehr besteht, sondern nur über § 857 BGB fingiert wird, ist der Eigentümer nicht mehr schutzbedürftig]. Dass der nur mittelbar besitzende Eigentümer hier eigentlich nicht mehr schutzwürdig ist, berücksichtigt die h.M. erst über § 2366 BGB, dazu unten 3.
2. gemäß §§ 929 S. 1, 2366 BGB? Der Erbschein fingiert nur den Bestand des Erbrechts (= Erwerb vom wahren Erben), nicht aber die Zugehörigkeit des Gegenstands zum Nachlass. Auch von der wahren Erbin hätte N nicht gemäß § 929 S. 1 BGB erwerben können.
3. gemäß §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1, 2366 BGB? Einigung, Übergabe, Einigsein (+), Berechtigung (-), denn E ist nicht Eigentümerin der Vase. Überwindung des Mangels der Berechtigung gemäß §§ 932 Abs. 1 S. 1, 2366 BGB? (+), denn N hätte von S (= Wirkung des § 2366 BGB) unter den Voraussetzungen der §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1 BGB (= Wirkung des § 932 BGB) Eigentum an der Vase erwerben können: N war nicht bösgläubig (sie hielt die Vase für einen Nachlassgegenstand), und auch § 935 Abs. 1 S. 2 BGB steht nicht entgegen, weil der Erwerb vom Scheinerben dem Erwerb vom wahren Erben gleichgestellt wird und der Scheinerbe wegen § 2366 BGB als Besitzer der Nachlasssachen gilt (Michalski/Schmidt ErbR § 25 Rn. 1293 ff.; Benner, Klausurenkurs im Familien- und Erbrecht, ErbR Fall 7 Rn. 1061 ff.; Olzen/Looschelders ErbR Rn. 965; ohne Begründung genauso Leipold ErbR § 18 Rn. 658; Helms ErbR § 16 Rn. 9).
4. Ergebnis: § 985 BGB (-), weil B nicht mehr Eigentümerin der Vase ist.
Hinweis zur Darstellung: Ich empfehle, diese Fragen wirklich „Stück für Stück“ abzuschreiten, um deutlich zu machen, welcher Rechtsgedanke (= welche Vorschrift) welchen Mangel der Berechtigung (materielles Recht oder Erbrecht oder beides) überwindet. Also zunächst nur § 932 BGB (fingiert das materielle Recht des Verfügenden), dann nur § 2366 BGB (fingiert das Erbrecht des Verfügenden) und dann §§ 2366, 932 BGB (fingiert sowohl das Erbrecht des Verfügenden als auch das materielle Recht des Erben) prüfen.
Beachte: Nach seinem Wortlaut ist § 2366 BGB auf Rechtsgeschäfte über Erbschaftsgegenstände (= Gegenstände, die zum Nachlass gehören) anwendbar. Dann könnte es einen solchen doppelt-gutgläubigen Erwerb streng genommen nicht geben, weil es an der Nachlasszugehörigkeit gerade fehlt. Heute besteht aber Einigkeit darüber, dass § 2366 BGB insoweit keine Ausnahme von den allgemeinen Regeln des gutgläubigen Erwerbs bedeuten soll. Die Sache muss sich aber immerhin „beim“ Nachlass befinden.
Abgrenzung: B wird eine Vase gestohlen. Hehlerin H veräußert sie an die gutgläubige Antiquarin A, die wiederum an den gutgläubigen X. Als X verstirbt, veräußert Scheinerbin Y die Vase als Nachlassgegenstand an die Z. Wahre Erbin ist aber die E. Nun erfährt B von den Vorgängen und verlangt die Vase von Z heraus. Zu Recht?
§ 985 BGB? Dazu müsste B noch Eigentümerin sein. Sie hat das Eigentum weder an H noch an A oder X verloren (§ 935 Abs. 1 S. 1 BGB). Auch ein Verlust durch Verfügung der Y zugunsten der Z gemäß §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1 BGB scheidet hier wegen § 935 Abs. 1 S. 1 BGB aus. Daran ändert auch die Legitimation der Y durch den Erbschein nichts, denn die wahre Erbin – E – hätte wegen § 935 Abs. 1 S. 1 BGB ebenfalls nicht wirksam das Eigentum übertragen können. Daher § 985 BGB (+).
Wichtig: § 2366 BGB überwindet nur die mangelnde Erbenstellung, nicht aber das mangelnde Eigentum des Erblassers und damit des wahren Erben (= Zugehörigkeit zum Nachlass); ggf. sind zusätzlich die §§ 932 ff., 892 f. BGB zu prüfen!
Leistungs- und andere Verfügungsgeschäfte (§ 2367 BGB)
§ 2367 BGB ergänzt § 2366 BGB ähnlich wie § 892 BGB im Verhältnis zu § 891 BGB. § 2367 BGB gilt insbesondere für alle sonstigen Verfügungen, die nicht auf den Erwerb, also die Übertragung eines Rechts gerichtet sind (z.B. Bestellung eines Grundpfandrechts, Inhaltsänderung, Aufhebung). Die Bestellung einer Vormerkung wird auch hier einem Rechtsgeschäft, das eine Verfügung über dieses Recht enthält, zumindest gleichgestellt (§ 2367 Alt. 2 BGB).
Als Verfügung über Nachlassgegenstände (nochmals: nicht nur Sachen!) wird außerdem die Ausübung von Gestaltungsrechten, die zu einer Umgestaltung von Vertragsrechten führen, gezählt, z.B. Kündigung, Aufrechnung, Anfechtung und Genehmigung gemäß § 185 BGB.
