Zur Einführung Röthel, Die gesetzliche Erbfolge, JURA 2018, 677 ff.
Gemäß § 1922 BGB geht das Vermögen auf den oder die Erben über. Wer Erbe ist, bestimmt die sog. Erbfolge. Diese kann auf dem Willen des Erblassers beruhen (sog. gewillkürte Erbfolge) oder – wenn der Erblasser keine oder keine wirksame Erbenbestimmung vorgenommen hat – auf der gesetzlichen Erbfolge. Im BGB ist die gesetzliche Erbfolge (§§ 1924 ff. BGB) vor der gewillkürten Erbfolge (§§ 1937 ff. BGB) geregelt. Der Gesetzgeber maß der gesetzlichen Erbfolge sowohl einen gewissen Gerechtigkeitswert bei (Leitbildfunktion) als auch hohe praktische Bedeutung. Beides ist bis heute richtig: Noch immer bestimmen sich etwa ¾ aller Nachlässe nach der gesetzlichen Erbfolge.
In der Klausur ist aber – anders als in der folgenden Darstellung – zunächst zu prüfen, ob durch Verfügung von Todes wegen eine Erbeinsetzung erfolgt ist, und erst danach ist ggf. die gesetzliche Erbfolge zu erläutern (Subsidiarität der gesetzlichen Erbfolge).
Allerdings kann es auch dann, wenn eine Verfügung von Todes wegen vorliegt, auf die gesetzliche Erbfolge ankommen, z.B. wenn der Erblasser darin keine Erbeinsetzungen vorgenommen hat, sondern nur Enterbungen (§ 1938 BGB) ausgesprochen oder Vermächtnisse (§ 1939 BGB) und Auflagen (§ 1940 BGB) bestimmt hat, oder wenn lediglich ein Bruchteil des Vermögens zugesprochen wurde („meine Freunde F1 und F2 erben je 1/3 meines Vermögens“; siehe § 2088 Abs. 1 BGB).
Gesetzliche Erben sind die Verwandten des Erblassers (dazu unter I.), daneben der Ehegatte oder Lebenspartner (dazu unter II.) und – subsidiär – der Fiskus (dazu unter III.).
Verwandtenerbrecht (§§ 1924 ff. BGB)
Verwandtschaft
Gesetzliche Erben sind die Verwandten des Erblassers. Der Nachlass wird also in der Familie weitergegeben. Daher wird das gesetzliche Erbrecht auch als Familienerbrecht bezeichnet. Wer Verwandter oder einem Verwandten gleichgestellt ist, bestimmt sich nach §§ 1589 ff. BGB.
Verwandtschaft kraft Abstammung (§§ 1589, 1591 ff. BGB)
Personen sind miteinander verwandt, wenn sie voneinander (§ 1589 S. 1 BGB – Verwandtschaft in gerader Linie) oder von einer dritten Person (§ 1589 S. 2 BGB – Verwandtschaft in der Seitenlinie) abstammen.
Mutter, Tochter und Großmutter sind Verwandte in gerader Linie. Geschwister, Cousin und Cousine sowie Tante und Nichte sind in der Seitenlinie verwandt.
Eine Person stammt von einer anderen ab, wenn Mutterschaft (§ 1591 BGB) oder Vaterschaft (§ 1592 BGB) vorliegt.
Vertiefungshinweis: Mutter ist stets die Frau, die das Kind geboren hat, auch wenn die Eizelle nicht von ihr stammt (§ 1591 BGB). Vater ist z.B., wer mit der Mutter im Zeitpunkt der Geburt verheiratet ist (§ 1592 Nr. 1 BGB), auch wenn er möglicherweise nicht der „wahre“, also biologische Vater ist (Einzelheiten dazu noch in der Vorlesung FamR).
Beispiel: A und B sind miteinander verheiratet. Kind K wird während der Ehe mit B geboren; biologischer Vater ist aber der G. Ist K im Erbfall gesetzlicher Erbe des B?
Obwohl G der biologische Vater des K ist, ist B dessen rechtlicher Vater (§ 1592 Nr. 1 BGB). K beerbt seinen „rechtlichen“ (nicht-biologischen) Vater B als dessen Kind im Wege der gesetzlichen Erbfolge gemäß § 1924 Abs. 1 BGB, ohne dass eine Anerkennungserklärung des B oder der Nachweis der Zeugung des K durch B notwendig wäre. Erst wenn die Nichtvaterschaft des B aufgrund einer Anfechtung rechtskräftig festgestellt ist (§§ 1600 ff. BGB), gehört K nicht mehr zu den gesetzlichen Erben des B.
Keine Verwandtschaft besteht bei Schwägerschaft (§ 1590 BGB). Auch die Eheschließung bzw. Begründung einer Lebenspartnerschaft begründen ebenfalls keine Verwandtschaft: Ehegatten/Lebenspartner sind nicht miteinander verwandt! Daher ist das Erbrecht des Ehegatten/Lebenspartners gesondert geregelt (§ 1931 BGB, § 10 LPartG).
Wichtig: Ob ein Kind ehelich oder unehelich geboren ist, spielt seit dem Erbrechtsgleichstellungsgesetz aus dem Jahr 1997 (BGBl. I 1997, 2968, in Kraft getreten am 1.4.1998) keine Rolle mehr für die gesetzliche Erbfolge. Es gelten dieselben Vorschriften; zur Rechtsentwicklung Leipold, ErbR Rn. 92 ff.
Verwandtschaft ohne Abstammung
Darüber hinaus kennt das BGB Fälle rechtlicher Verwandtschaft, die nicht auf Abstammung beruhen.
Die Adoption Minderjähriger (§§ 1741 ff. BGB) führt dazu, dass der Angenommene einem Kind des Annehmenden gleichgestellt wird: Das adoptierte Kind erlangt die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes des Annehmenden bzw. eines gemeinschaftlichen Kindes beider Ehegatten (§ 1754 BGB). Das angenommene Kind und dessen Abkömmlinge (= Kinder, Enkel etc.) werden gesetzliche Erben der Adoptiveltern und deren Verwandten. Zugleich erlischt das Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern (Grundsatz der Volladoption, § 1755 Abs. 1 S. 1 BGB; Ausnahmen: §§ 1755 Abs. 2, 1756 BGB).
Anders verhält es sich bei der Adoption Volljähriger: Das Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen Verwandten erlischt nicht (§ 1770 BGB). Die Adoptionswirkung beschränkt sich darauf, dass ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem Adoptierten und dessen Abkömmlingen mit dem Annehmenden, nicht aber auch mit dessen Verwandten begründet wird.
Beispiel: K wird am Vortag seines 18. Geburtstags von den Ehegatten A und B adoptiert. Am 18. Geburtstag versterben seine leiblichen Eltern E bei einem Verkehrsunfall. Ist K gesetzlicher Erbe der E?
Wegen der Adoption als Minderjähriger (§ 2 BGB) ist das Verwandtschaftsverhältnis des K zu seinen leiblichen Eltern E erloschen (§ 1755 BGB). Ab dem Zeitpunkt der Adoption (hier dem Tag vor dem tödlichen Verkehrsunfall) ist K nicht mehr gesetzlicher Erbe der E, sondern ausschließlich gesetzlicher Erbe der neuen Eltern A und B und deren Verwandten.
Grundprinzipien
Die Grundentscheidung des deutschen Verwandtenerbrechts ist die Entscheidung für das Ordnungsprinzip oder Parentelprinzip (lat. parens, Elternteil). Die Verwandten werden danach eingeteilt, von welcher Person sie abstammen: vom Erblasser selbst (1. Ordnung), von den Eltern des Erblassers (2. Ordnung), von den Großeltern des Erblassers (3. Ordnung). Mit der Entscheidung zugunsten des Ordnungsprinzips werden im Regelfall die Abkömmlinge des Erblassers zu Erben berufen und damit eine Vermögensweitergabe nach „unten“ verwirklicht.
Vertiefungshinweis: Die Alternative zum Ordnungsprinzip ist das Gradualprinzip, also die Berufung nach dem Grad der Verwandtschaft, d.h. nach der Anzahl der sie vermittelnden Geburten (§ 1589 BGB). Danach stünde beispielsweise die Mutter des Erblassers (1. Grad) dem Erblasser näher als dessen Enkel (2. Grad). Mit der Entscheidung für das Ordnungsprinzip ist aber vorrangig der Enkel erbberechtigt. Der Gesetzgeber hat das Gradualprinzip nur in den entfernteren Ordnungen verwirklicht (§§ 1928 Abs. 3, 1929 Abs. 2 BGB).
Im Verhältnis der Ordnungen zueinander gilt das Rangfolgeprinzip (§ 1930 BGB): Verwandte der vorhergehenden Ordnung hindern die Erbenstellung von Verwandten höherer Ordnungen. Erben der zweiten Ordnung kommen nur zum Zug, wenn der Erblasser keinen Abkömmling hinterlässt, Erben der dritten Ordnung nur, wenn auch in der zweiten Ordnung kein Verwandter den Erblasser überlebt usw.
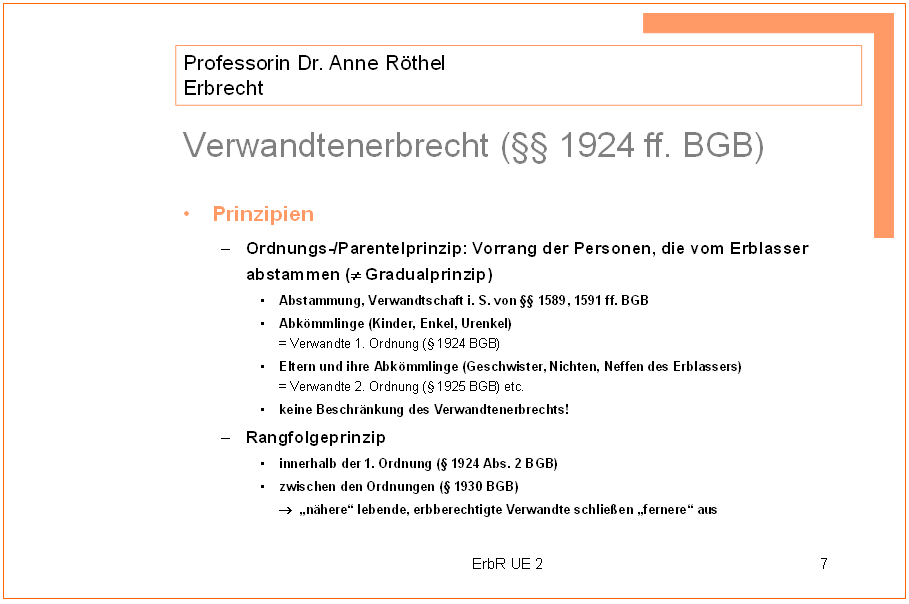
Verwandtenerbrecht innerhalb der ersten bis zur vierten Ordnung
Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers (§ 1924 Abs. 1 BGB).
Hinweis: „Abkömmlinge“ meint dabei sämtliche „Nachfahren“ (Deszendenten), also Kinder, Enkel, Urenkel etc. Nur wo im Erbrecht ausdrücklich von „Kind“ die Rede ist (etwa §§ 1924 Abs. 4, 2068 BGB), sind ausschließlich die unmittelbaren Nachfahren gemeint.
Innerhalb der ersten Ordnung erfolgt die Erbfolge nach Stämmen. Jedes Kind (!) des Erblassers bildet mit seinen Abkömmlingen einen Stamm. Jeder Stamm erhält den gleichen Erbteil (§ 1924 Abs. 4 BGB). Ein zur Zeit des Todes lebender, erbberechtigter Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus (§ 1924 Abs. 2 BGB). An die Stelle eines zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht mehr lebenden bzw. nicht erbberechtigten Abkömmlings treten die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge (§ 1924 Abs. 3 BGB, sog. Eintrittsrecht).
Beispiel zur Erbfolge innerhalb der ersten Ordnung: Nach dem Tod seiner Ehefrau verlässt auch den M am 1.5.1998 der Lebenswille. M hinterlässt seine Eltern GM und GV, die ehelichen Kinder K2 und K3 sowie einen nichtehelichen Sohn S. Das älteste Kind K1 ist vorverstorben, hinterlässt die Enkel E1 und E2. Auch K3 hat ein Kind, E3. Wer erbt?
Da M Abkömmlinge (Kinder K2 und K3, Sohn S, Enkel E1 und E2) hinterlässt, sind die Eltern als Erben zweiter Ordnung (§ 1925 Abs. 1 BGB) von der Erbfolge ausgeschlossen (Rangfolgeprinzip, § 1930 BGB). Zu den Erben der ersten Ordnung gehört neben K2 und K3 auch der nichteheliche Sohn S. Die Kinder des K3 sind von der Erbfolge ausgeschlossen (§ 1924 Abs. 2 BGB). Anders liegt es bei den Kindern des vorverstorbenen K1: Sie treten an die Stelle von K1 (§ 1924 Abs. 3 BGB). Im Ergebnis erben daher S, K2 und K3 je ¼, und E1 und E2 teilen sich das 1/4 des K1, erben also je 1/8.
Vertiefung nach BGHZ 189, 171 ff.: Nach dem Wortlaut der § 1924 Abs. 2 und Abs. 3 BGB schließt nur ein „lebender“ Abkömmling entferntere Abkömmlinge aus. Doch kommt es eigentlich nicht darauf an, ob ein näherer Abkömmling „lebt“, sondern ob er „erbt“. Ein gesetzliches Erbrecht des entfernteren Abkömmlings besteht vielmehr auch, wenn der nähere Abkömmling zwar lebt, aber nicht Erbe wird, weil er die Erbschaft ausgeschlagen hat (wegen § 1953 Abs. 2 BGB), für erbunwürdig erklärt wurde (wegen § 2344 Abs. 2 BGB) oder einen beschränkten Erbverzicht erklärt hat (wegen §§ 2346 Abs. 1 S. 2, 2349 BGB). Für den Fall, dass der nähere Abkömmling durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen wurde, ist dies zwar nicht gesetzlich geregelt, doch hat der BGH auch hierfür in BGHZ 189, 171 ff. ein Eintrittsrecht des entfernteren Abkömmlings angenommen und also in Richtung „Gleichlauf“ entschieden.
Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, also die Geschwister, Neffen und Nichten sowie Großneffen und Großnichten des Erblassers (§ 1925 Abs. 1 BGB). Anders als in der ersten Ordnung werden die Erben in der zweiten Ordnung nicht nach Stämmen, sondern nach Linien bestimmt. Jeder Elternteil des Erblassers bildet mit seinen Nachkommen eine Linie. Leben zur Zeit des Erbfalls beide Eltern, erben sie allein und zu gleichen Teilen (§ 1925 Abs. 2 BGB). An die Stelle eines vorverstorbenen Elternteils treten dessen Abkömmlinge (§ 1925 Abs. 3 S. 1 BGB, Eintrittsrecht). Ist ein Elternteil vorverstorben, ohne Abkömmlinge zu hinterlassen, fällt sein Erbteil an den anderen Elternteil (§ 1925 Abs. 3 S. 2 BGB). Ist dieser auch vorverstorben, fällt der Erbteil an dessen einseitige Abkömmlinge (§ 1925 Abs. 3 S. 1 BGB).
Beispiel zur Erbfolge innerhalb der zweiten Ordnung: E verstirbt unverheiratet und kinderlos. Außer seiner Mutter M und seiner Schwester S1 lebt noch seine Nichte N, die Tochter seiner anderen, ebenfalls schon verstorbenen Schwester S2. Aus erster Ehe seines verstorbenen Vaters V stammt sein Halbbruder H. Wer erbt?
Da E keine Abkömmlinge hinterlässt, sind die Verwandten der zweiten Ordnung zur Erbfolge berufen. M erbt die Hälfte des Nachlasses (§ 1925 Abs. 2 BGB). Die auf die väterliche Linie entfallende andere Hälfte (vgl. § 1925 Abs. 2 BGB) verteilt sich auf die Schwester S1, auf N (sie tritt nach § 1925 Abs. 3 S. 1 i.V. mit § 1924 Abs. 3 BGB an die Stelle von S2) und auf H zu je 1/6.
Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, also Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen des Erblassers sowie deren Abkömmlinge (§ 1926 Abs. 1 BGB). Auch in der dritten Ordnung wird die Erbfolge nicht nach Stämmen, sondern nach Linien bestimmt. Jeder Großelternteil bildet mit seinen Abkömmlingen eine Linie. Leben die Großeltern zur Zeit des Erbfalls, erben sie allein und zu gleichen Teilen (§ 1926 Abs. 2 BGB). Ist zur Zeit des Erbfalls ein Großvater oder eine Großmutter eines Großelternpaars vorverstorben, treten an die Stelle des Vorverstorbenen dessen Abkömmlinge (§ 1926 Abs. 3 S. 1 BGB, Eintrittsrecht). Sind keine Abkömmlinge vorhanden, fällt der Anteil des Vorverstorbenen dem anderen Teil des Großelternpaars oder, wenn er auch vorverstorben ist, dessen Abkömmlingen zu (§ 1926 Abs. 3 S. 2 BGB). Sind beide Großeltern einer Linie vorverstorben und hinterlassen auch keine Abkömmlinge, fällt ihr Anteil zu gleichen Teilen an die andere Großelternlinie (§ 1926 Abs. 4 BGB).
Beispiel zur Erbfolge innerhalb der dritten Ordnung: Als E verstirbt, hinterlässt sie weder Verwandte der ersten noch der zweiten Ordnung. Es leben aber noch ihre beiden Großmütter GM1 und GM2. Ihre beiden Großväter GV1 und GV2 sind bereits vorverstorben. GV2 hinterlässt allerdings aus seiner Ehe mit GM2 die Tante T und den Onkel O der E, die zur Zeit des Erbfalls beide noch leben. Wer erbt?
Wegen § 1926 Abs. 2 BGB würden die Großeltern, wenn sie noch alle lebten, zu gleichen Teilen erben (jeder ¼ des Nachlasses). Da GV1 vorverstorben ist, ohne Nachkommen zu hinterlassen, fällt sein Anteil an GM1 (§ 1926 Abs. 3 S. 2 BGB). GM1 erhält also einen Anteil von ½. Der Anteil des GV2 i. H. von 1/4 fällt T und O zu, die als Abkömmlinge des GV2 an dessen Stelle treten. T und O erhalten je 1/8 (§ 1926 Abs. 3 S. 1, Abs. 5 BGB). GM2 erhält ¼.
Erben der vierten Ordnung sind die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge (§ 1928 Abs. 1 BGB). Leben die Urgroßeltern zur Zeit des Erbfalls, erben sie allein und zu gleichen Teilen (§ 1928 Abs. 2 BGB). Leben sie zur Zeit des Erbfalls nicht mehr, erbt von ihren Abkömmlingen derjenige, der mit dem Erblasser dem Grade nach am nächsten verwandt ist (§ 1928 Abs. 3 BGB, Gradualprinzip). Der Grad der Verwandtschaft wird durch die Zahl der sie vermittelnden Geburten bestimmt (§ 1589 S. 3 BGB).
Auch für die Erben der fünften Ordnung und die noch ferneren Ordnungen (§ 1929 BGB) gilt das Gradualprinzip.
Klausurhinweis: Die gesetzliche Erbfolge ab der zweiten Ordnung wird den Rahmen der im Examen verlangten Grundkenntnisse übersteigen. Wichtig ist aber das Verständnis von §§ 1924, 1930 BGB sowie von § 1931 BGB, dazu sogleich:
Erbrecht des Ehegatten/Lebenspartners
Ehegatten sind nicht kraft ihrer Eheschließung miteinander verwandt (!). Dies ergibt sich e contrario auch aus § 1931 BGB: Ein eigenes gesetzliches Erbrecht des Ehegatten wäre sonst entbehrlich. Dem Ehegatten erbrechtlich im Wesentlichen gleichgestellt ist der eingetragene Lebenspartner (§ 10 Abs. 1−3 LPartG).
Beachte: Natürlich können Personen, die nicht gesetzlich erbberechtigt sind, durch gewillkürte Erbfolge eingesetzt werden, z.B. Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Die Unterschiede der rechtlichen „Anerkennung“ zeigen sich dann allerdings im Erbschaftsteuerrecht, das Verwandte und Ehegatten der ersten Steuerklasse zuordnet und ihnen einen Freibetrag von nunmehr 500.000 € gewährt, während nichteheliche Lebensgefährten wie sonstige Dritte der dritten Steuerklasse zugeordnet werden mit einem Freibetrag von 20.000 €, siehe §§ 15 Abs. 1, 16 Abs. 1 ErbSchStG. Dagegen gilt für eingetragene Lebenspartner i.S. des LPartG inzwischen auch der Ehegattenfreibetrag von 500.000 € und dieselbe Steuerklasse wie für Ehegatten (§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 16 Abs. 1 ErbSchStG).
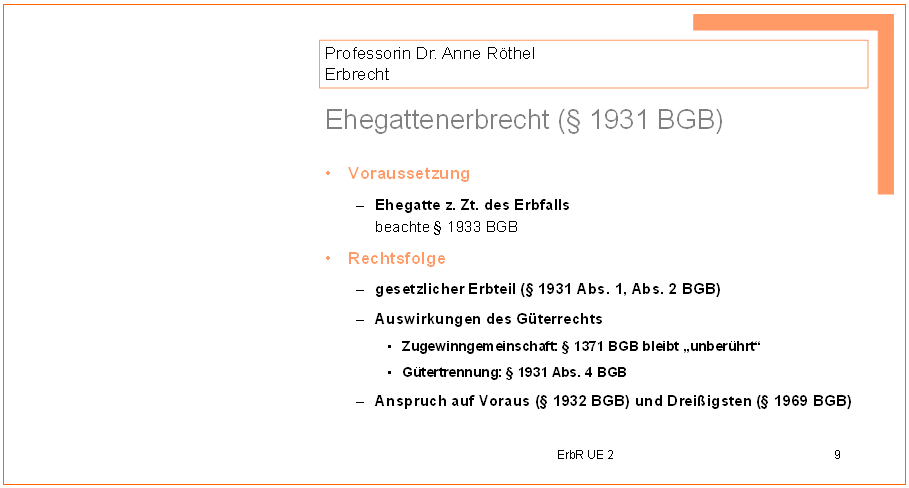
Wirksame Ehe im Zeitpunkt des Erbfalls
Nur der „Ehegatte“ hat ein gesetzliches Erbrecht. Daran fehlt es, wenn die Ehe zur Zeit des Erbfalls geschieden (§§ 1564 ff. BGB), aufgehoben (§§ 1313 ff. BGB) oder nichtig (§ 1310 BGB) ist.
Wichtig: Mit der Scheidung entfällt das gesetzliche Erbrecht! Der Geschiedene hat dann allenfalls noch Unterhaltsansprüche: Unterhaltsansprüche erlöschen mit dem Tod des unterhaltsverpflichteten Ex-Ehegatten nicht, sondern richten sich nun gegen die Erben des Ex-Ehegatten (§ 1586b BGB).
Eine Ausnahme gilt gemäß § 1933 BGB für den Fall, dass ein Ehegatte im Zuge des Scheidungsverfahrens stirbt. Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten ist ausgeschlossen, wenn der Erblasser (!) die Scheidung beantragt (§ 1564 Abs. 1 BGB) oder ihr zugestimmt hatte (§ 1566 Abs. 1 BGB) und die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe (§§ 1565−1568 BGB) gegeben waren, insbesondere also wenn die Ehegatten bereits ein Jahr getrennt gelebt haben.
Beispiel: M und F sind miteinander verheiratet. Am 1.3.2024 beantragt M die Scheidung. Am 15.3.2024 stirbt F, ohne ein Testament zu hinterlassen. M beantragt einen Erbschein, der ihn als Alleinerben ausweist. Ist M Erbe geworden?
Zwar ist M immer noch Ehegatte im Zeitpunkt des Erbfalls, weil die Ehe noch nicht geschieden ist. Denn die Scheidung erfolgt durch Gestaltungsurteil, das hier noch nicht vorliegt. Das Erbrecht des M könnte jedoch gemäß § 1933 BGB erloschen sein. Hier hatte die F – und nur auf sie kommt es nach dem Wortlaut des § 1933 BGB an, weil sie Erblasserin ist – allerdings weder die Scheidung beantragt noch ihr zugestimmt. Daher führt § 1933 BGB nicht zum Erlöschen des Erbrechts des M.
Vielfach wird bezweifelt, ob § 1933 BGB sachgerecht ist, weil die Vorschrift gerade dann nicht eingreift, wenn der andere Ehegatte die Scheidung beantragt hat. Hinter § 1933 BGB stand die Vorstellung, dass es dem vermuteten Willen des Erblassers, der sich selbst von der Ehe löst, nicht entspreche, dem anderen Ehegatten ein Erbrecht einzuräumen. Heute wird diese Einseitigkeit des § 1933 BGB vielfach kritisiert; vgl. Leipold, MüKoBGB § 1933 Rn. 3: Vorschrift solle auf den Fall des beiderseitigen Scheidungsbegehrens beschränkt werden, so auch Röthel, Gutachten A zum 68. DJ; anders Staudinger/Otte, 2017, Einl. ErbR Rn. 87a.
§ 1931 Abs. 1, Abs. 2 BGB
Erstens kommt es darauf an, mit welchen Verwandten des Erblassers (!) der überlebende Ehegatte zusammentrifft.
Das Folgende ergibt sich allein aus dem Gesetzestext – auswendig lernen nicht erforderlich!
Der Ehegatte ist neben Verwandten der ersten Ordnung (§ 1924 Abs. 1 BGB: Abkömmlinge) zu ¼, neben Verwandten der zweiten Ordnung (§ 1925 Abs. 1 BGB: Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, also Geschwister des Erblassers) zu ½ erbberechtigt (§ 1931 Abs. 1 BGB). Sind weder Verwandte der ersten noch der zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden, ist der Ehegatte Alleinerbe (§ 1931 Abs. 2 BGB).
Beispiel: Erblasserin E hinterlässt ihre Ehefrau F, ihre Kinder K1 und K2, ihre Mutter M sowie die Kinder E1 und E2 ihres vorverstorbenen Kindes K3. Ohne Berücksichtigung des Güterrechts ergibt sich für F eine Erbquote von ¼, genauso für K1 und K2, während sich E1 und E2 das Viertel von K3 teilen, also je 1/8.
Hinweis: Dass der Ehegatte neben Kindern „nur“ ¼ erbt, erscheint heute zunehmend befremdlich. Zahlreiche ausländische Rechtsordnungen haben die erbrechtliche Stellung des Ehegatten verstärkt (sog. Horizontalisierungstendenz der gesetzlichen Erbfolge). Vielfach ist der Ehegatte der wirtschaftliche Alleinnachfolger (z.B. in den Niederlanden seit dem Jahr 2003). Die Besonderheit des deutschen Rechts liegt allerdings darin, dass zu diesem erbrechtlichen ¼ ggf. noch ein güterrechtliches ¼ hinzutritt, dazu gleich unten b).
Gehört der Ehegatte zu den erbberechtigten Verwandten des Erblassers (beachte aber das Eheverbot von § 1307 BGB), erbt er zugleich als Verwandter (§ 1934 S. 1 BGB). Es handelt sich dann bei dem Ehegatten- und dem Verwandtenerbteil um zwei verschiedene Erbteile, die voneinander getrennt werden (§ 1934 S. 2 BGB). Dies hat u.a. Bedeutung für die Ausschlagung der Erbschaft (dazu eingehend bei ErbR 3).
Beispiel: Erblasser E hinterlässt seine Ehefrau F, die seine Nichte ist, und seine Mutter M. – F erbt neben Angehörigen der zweiten Ordnung, d.h. zu ½ (§ 1931 Abs. 1 S. 1 BGB). Von der anderen Hälfte erbt M ½, also ¼. Das restliche ¼ geht an F, da sie zugleich Nichte des E ist (§ 1925 Abs. 3 S. 1 BGB). F erbt also ¾ und M ¼ des Nachlasses (ohne Berücksichtigung des Güterstands).
Güterrechtliche Korrekturen (§ 1931 Abs. 3, Abs. 4 BGB)
Es gehört zu den Besonderheiten des deutschen Erbrechts, dass sich die erbrechtliche Stellung des Ehegatten auch danach bestimmt, in welchem Güterstand die Ehegatten lebten. Gemeint ist, dass das BGB unterscheidet zwischen einem ohnehin bestehenden Erbteil (oben a) und einer Begünstigung, die darauf beruht, dass mit dem Tod des anderen Ehegatten zugleich der Güterstand aufgelöst wird. Von Bedeutung ist dies gerade dann, wenn die Ehegatten – wie im Regelfall – im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebten. Dies bestimmt sich nach § 1931 Abs. 3 und Abs. 4 BGB.
Gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft): § 1931 Abs. 3 BGB
§ 1931 Abs. 3 BGB ist auf den ersten Blick schwer zu verstehen: „§ 1371 BGB bleibt unberührt“. Gemeint ist, dass neben § 1931 Abs. 1 und Abs. 2 BGB auch ein Ausgleich gemäß § 1371 BGB stattfindet. § 1371 BGB regelt den Ausgleich der Zugewinngemeinschaft, wenn die Ehe durch den Tod des Ehegatten geschieden wird.
Aus dem systematischen Zusammenhang von § 1371 BGB innerhalb der §§ 1363 ff. BGB ergibt sich also, dass §§ 1931 Abs. 3, 1371 BGB eine besondere Regelung für den gesetzlichen Güterstand bedeutet.
Im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft (§ 1363 BGB) leben Ehegatten immer dann, wenn sie nicht durch Ehevertrag einen anderen Güterstand vereinbart haben.
Hinweis: Wenn im Sachverhalt nichts weiter enthalten ist, können Sie davon ausgehen, dass die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand leben.
Die Zugewinngemeinschaft wird im Einzelnen in der Vorlesung FamR dargestellt. Hier geht es nur um den Ausgleich bei Auflösung der Ehe durch den Tod eines Ehegatten:
Erhöhung des gesetzlichen Erbteils (§ 1371 Abs. 1 BGB)
Wird die Ehe durch den Tod eines Ehegatten geschieden, wird die Zugewinngemeinschaft dadurch ausgeglichen, dass der längerlebende Ehegatte zusätzlich zu seinem gesetzlichen Erbteil von § 1931 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BGB pauschal eine Erbquote von weiteren ¼ erhält.
Wichtig: Bei dieser Lösung kommt es nicht darauf an, ob der längerlebende Ehegatte bei rechnerischer Auflösung der Zugewinngemeinschaft einen entsprechenden Ausgleichsanspruch gehabt hätte. Wenden die Kinder des Erblassers etwa ein, dem überlebenden Ehegatten stünde gar kein Zugewinnanspruch zu, so geht dieser Einwand ins Leere.
Neben Abkömmlingen des Erblassers erbt der Ehegatte also ¼ + ¼ = ½ des Nachlasses. Neben Verwandten der zweiten Ordnung sowie neben Großeltern erbt der Ehegatte ½ + ¼ = ¾.
Beispiel: M und F lebten im gesetzlichen Güterstand. M war und blieb vermögenslos; auch ein Testament hat er nicht aufgesetzt. Aus der Ehe sind die Kinder K1-K6 hervorgegangen. Wie ist die Erbfolge, wenn M verstirbt?
Gesetzliche Erben erster Ordnung sind die Kinder K1-K6 (§ 1924 Abs. 1 BGB) zu gleichen Teilen (§ 1924 Abs. 4 BGB). Neben den Kindern ist F zu ¼ erbberechtigt (§ 1931 Abs. 1 BGB), zzgl. der güterrechtlichen Erhöhung um ¼ (§ 1371 Abs. 1 BGB), so dass F insgesamt ½ erbt und die Kinder K1-K6 je 1/12.
§ 1371 Abs. 1 BGB ist zwingend („wird ... verwirklicht“); der Ehegatte kann also nicht zwischen pauschalierter und tatsächlicher Durchführung des Zugewinnausgleichs wählen. Dadurch sollen Auseinandersetzungen um die Berechnung der Ausgleichsforderung zwischen den Erben vermieden werden.
Beachte: § 1371 Abs. 1 BGB führt zu einer Erhöhung des gesetzlichen Erbteils, d.h. die Vorschrift gilt nur, wenn die gesetzliche Erbfolge auch eintritt. Bei gewillkürter Erbfolge ist § 1371 Abs. 1 BGB ohne Bedeutung für das Erbrecht des Ehegatten. Der gesetzliche Erbteil des Ehegatten kann sich dann aber immer noch indirekt auswirken, wenn es um das Pflichtteilsrecht z.B. der Kinder geht, dazu noch eingehend später.
Exkurs: Ehegatte wird nicht Erbe (§ 1371 Abs. 2 BGB)
Die Erhöhung des gesetzlichen Erbteils setzt voraus, dass der Ehegatte überhaupt Erbe geworden ist und dass er gesetzlicher Erbe geworden ist (arg. e contrario § 1371 Abs. 2 BGB). Wird der überlebende Ehegatte nicht gesetzlicher Erbe – infolge Erbunwürdigkeit (§§ 2339 ff. BGB), Erbverzichts (§§ 2346 ff. BGB), Enterbung (§ 1938 BGB) oder Ausschlagung (§§ 1942 ff. BGB) –, findet der Zugewinnausgleich nach den güterrechtlichen Vorschriften statt (§§ 1371 Abs. 2, 1373 ff., 1378 BGB).
Beispiel: Erblasser E hinterlässt ein Kind K aus erster Ehe und seine zweite Ehefrau F, mit der er seit sechs Monaten verheiratet war. Weil E schlechte Erfahrungen mit der Ehe gemacht hat, hatte er die F kurz nach der Eheschließung testamentarisch enterbt. Wer erbt?
Infolge der testamentarischen Enterbung der E (§ 1938 BGB) ist K1 Alleinerbe (gesetzlicher Erbe erster Ordnung gemäß § 1924 Abs. 1 BGB). F hat gegen K1 aber – je nach den wirtschaftlichen Verhältnissen – einen Anspruch auf Ausgleich (§ 1371 Abs. 2 BGB) des „rechnerischen“ Zugewinns. Dieser Anspruch ist eine Nachlassverbindlichkeit, für die K1 haftet (§ 1967 BGB). Darüber hinaus kann sie aufgrund ihrer Enterbung den sog. kleinen Pflichtteil verlangen, der sich gemäß §§ 2303 Abs. 2 S. 1, 1371 Abs. 2 2. HS BGB nach dem nicht erhöhten gesetzlichen Erbteil des Ehegatten bestimmt. Wegen § 2303 Abs. 1 S. 2 BGB erhält F also zusätzlich 1/8 des Nachlasses (Hälfte des Wertes von dem Nachlassviertel, das F gemäß § 1931 Abs. 1 BGB neben K als Verwandten erster Ordnung zusteht). Dazu später nochmals im Zusammenhang mit dem Pflichtteilsrecht.
Ist der Ehegatte zwar Erbe, will er aber die Erbschaft ausschlagen, kann er neben dem „rechnerischen“, also konkret berechneten Zugewinnausgleich ausnahmsweise gleichwohl den Pflichtteil fordern (§ 1371 Abs. 3 BGB).
Vertiefungshinweis: Normalerweise bestehen Pflichtteilsansprüche nur dann, wenn man nicht Erbe geworden ist. Wer ein Erbe ausschlägt, ist aber Erbe geworden und daher nicht schutzwürdig.
Der Pflichtteil wird auch in diesem Fall nur gemäß § 1931 BGB berechnet, meint also den nicht durch § 1371 Abs. 1 BGB erhöhten Pflichtteil (sog. kleiner Pflichtteil). Die Ausschlagung der Erbschaft kann für den überlebenden Ehegatten dann sinnvoll sein, wenn der Nachlass zu einem erheblichen Teil aus Zugewinn besteht (Dethloff, FamR § 5 Rn. 135).
Beachte: Der überlebende Ehegatte, der nicht Erbe ist, kann aber nicht nach seiner Wahl anstelle des rechnerischen Zugewinnausgleichs zzgl. kleinem Pflichtteil den sog. großen Pflichtteil (d.h. gemessen an dem gemäß § 1371 Abs. 1 BGB erhöhten Erbteil) geltend machen. Faustregel: „Kein Wahlrecht auf den sog. großen Pflichtteil“ (BGHZ 42, 182).
Gütertrennung (§ 1931 Abs. 4 BGB)
Haben Eheleute durch Ehevertrag abweichend vom gesetzlichen Güterstand den Güterstand der Gütertrennung vereinbart (§ 1414 BGB), bemisst sich die gesetzliche Erbquote des überlebenden Ehegatten grundsätzlich allein nach § 1931 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BGB.
§ 1931 BGB sorgfältig lesen: § 1931 Abs. 3 BGB bezieht sich nur auf den gesetzlichen Güterstand, § 1931 Abs. 4 BGB nur auf die Gütertrennung.
Vertiefungshinweis: Die Gütertrennung unterscheidet sich vom gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft dadurch, dass bei Beendigung des Güterstands kein Ausgleich stattfindet. Es gibt daher keine Regelung, die § 1371 BGB vergleichbar wäre.
§ 1931 Abs. 4 BGB trifft nun eine Sonderregelung: Sind als gesetzliche Erben neben dem Ehegatten ein oder zwei Kinder (!) des Erblassers berufen, erben der überlebende Ehegatte und jedes Kind zu gleichen Teilen. Dies gilt auch, wenn vorverstorbene Kinder Abkömmlinge hinterlassen haben (§ 1931 Abs. 4 a.E. i. V. mit § 1924 Abs. 3 BGB).
Beispiel: M und F leben in Gütertrennung und haben die Kinder K1 und K2. Erbfolge nach dem Tod des M?
Trifft ein Ehegatte mit Verwandten zusammen, empfiehlt es sich, zunächst die Erbquote des Ehegatten zu ermitteln. Hier erbt F neben den Kindern gemäß § 1931 Abs. 1 BGB ¼. Die verbleibenden ¾ würden sich K1 und K2 teilen. Dies würde dazu führen, dass F weniger als K1 und K2 erbte, ohne dass ein weiterer güterrechtlicher Ausgleich stattfindet. Um dies zu verhindern (Streitvermeidung, vermuteter Erblasserwille), ordnet § 1931 Abs. 4 BGB an, dass F neben K1 und K2 zu gleichen Teilen erbt, also jeder 1/3. Diese Erhöhung hat keine güterrechtlichen Gründe, sondern geschieht allein aus erbrechtlichen Gerechtigkeitserwägungen.
Voraus, Dreißigster (§§ 1932, 1969 BGB)
Anspruch auf den Voraus (§ 1932 BGB)
Neben dem gesetzlichen Erbrecht hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf den sog. Voraus (§ 1932 Abs. 1 BGB). Gemeint sind Gegenstände, die zum ehelichen Haushalt gehörten (soweit sie nicht Zubehör eines Grundstücks sind, vgl. § 97 BGB) und die Hochzeitsgeschenke.
Beispiel: Möbel, Geschirr, Küchengeräte, aber auch wertvolle Bilder und Teppiche und der zu familiären Zwecken genutzte Pkw (Leipold, ErbR Rn. 194 m.w.N.).
Beachte: Was zum Voraus gehört, geht auf den Ehegatten nicht als Erben automatisch über (§ 1922 BGB), sondern der überlebende Ehegatte hat lediglich einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung. Dies ergibt sich aus der Verweisung in § 1932 Abs. 2 BGB auf die Vorschriften für Vermächtnisse (§§ 2147 ff., 2174 BGB). – Auf den Voraus kommt es daher nicht an, wenn der überlebende Ehegatte ohnehin schon Alleinerbe ist (§ 1931 Abs. 2 BGB).
Im Einzelnen hängt der Umfang des Anspruchs davon ab, mit welchen Verwandten der Ehegatte zusammentrifft (lies § 1932 Abs. 1 S. 1 und S. 2 BGB).
Anspruch auf den sog. Dreißigsten
Der Erbe ist verpflichtet, Familienangehörigen des Erblassers, die zu seinem Hausstand gehörten und von ihm Unterhalt bezogen, vom Erbfall an 30 Tage lang in gleicher Weise wie bisher Unterhalt zu gewähren sowie diesen Personen für diesen Zeitraum die weitere Benutzung des Wohnraums und der Haushaltsgegenstände zu gestatten (§ 1969 BGB, sog. Dreißigster). Familienangehörige sind der Ehegatte, die Kinder sowie sonstige Verwandte, ebenso der Lebenspartner (§ 11 LPartG), aber auch Pflegekinder oder der Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft (OLG Düsseldorf NJW 1983, 1566; Siegmann, MüKoBGB § 1969 Rn. 2; Jauernig/Stürner, BGB § 1969 Rn. 1).
Beachte: Ehegatten sind zwar nicht miteinander verwandt i. S. von § 1589 BGB, aber sie sind (selbstverständlich) Familienangehörige, und zwar auch dann, wenn sie keine Kinder haben.
§ 1969 BGB kann den überlebenden Ehegatten sowohl berechtigen (z.B. Anspruch des Ehegatten gegen das alleinerbende Kind) als auch verpflichten (z.B. alleinerbender Ehegatte gegenüber nichtehelichem Lebensgefährten des Erblassers [unwahrscheinlich]).
Erbrecht eingetragener Lebenspartner
Lebenspartner i. S. des LPartG sind dem Ehegatten erbrechtlich weitgehend gleichgestellt (§ 10 LPartG).
Neben Verwandten der ersten Ordnung (= Kindern des Erblassers!) erben Lebenspartner ¼, neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern ½ der Erbschaft (§ 10 Abs. 1 S. 1 LPartG). Sind weder Erben der ersten noch der zweiten Ordnung bzw. Großeltern vorhanden, sind Lebenspartner Alleinerben (§ 10 Abs. 2 LPartG). Lebten Lebenspartner im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, gilt außerdem § 1371 BGB entsprechend (§ 6 S. 2 LPartG). Bei Gütertrennung gilt § 10 Abs. 2 S. 2 LPartG. Das Erbrecht der Lebenspartner erlischt entsprechend § 1933 BGB, wenn die Voraussetzungen für die Aufhebung der Lebenspartnerschaft gegeben waren und der Erblasser einen Antrag auf Aufhebung gestellt oder ihr zugestimmt hat (§ 10 Abs. 3 LPartG).
Nochmals: Wer gehört nicht zu den gesetzlichen Erben? Nichteheliche Lebensgefährten. § 1931 BGB ist auf nichteheliche Lebensgefährten auch nicht analog anwendbar (AllgM, vgl. OLG Saarbrücken, 18.5.1979 - 7 W 8/79 = NJW 1979, 2050).
Erbrecht des Staates
Der Staat erbt als gesetzlicher Erbe, wenn bei gesetzlicher Erbfolge zur Zeit des Erbfalls weder ein Verwandter, ein Lebenspartner noch ein Ehegatte des Erblassers vorhanden ist (§ 1936 S. 1 BGB). Erforderlich ist also, dass das Verwandten- und das Ehegattenerbrecht ausscheiden. In der Praxis beruht dies meist darauf, dass die Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben. Träger des gesetzlichen Erbrechts ist der Fiskus des Bundeslandes, in dem der Erblasser seinen Wohnsitz bzw. seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, ansonsten der Bund.
Hinweis: In Deutschland ist das Verwandtenerbrecht – anders als in zahlreichen europäischen Rechtsordnungen – nicht beschränkt worden. Auch ein Verwandter fünfter Ordnung geht dem Staat noch vor. Das Aufspüren solcher entfernter Verwandter wird in der Praxis von gewerblichen Erbensuchern übernommen.
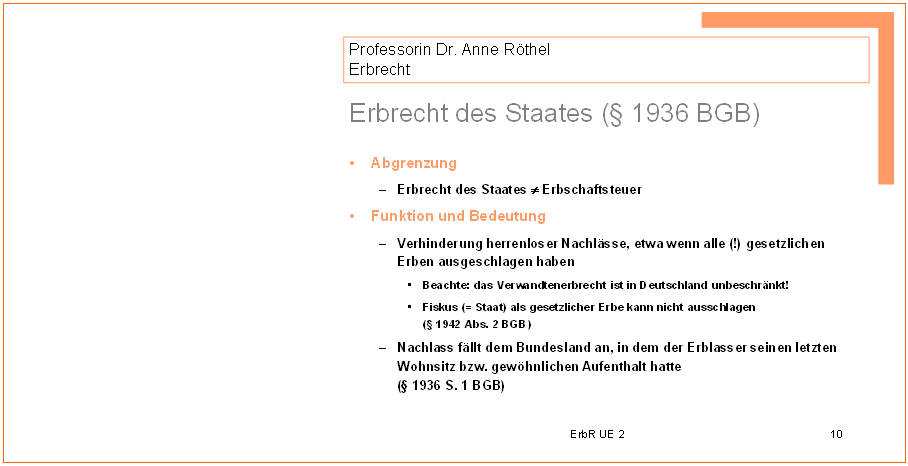
Ausnahme: Erbverzicht (§§ 2346 ff. BGB)
Von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen ist, wer durch notariell beurkundeten Vertrag mit dem Erblasser, also zu dessen Lebzeiten (!), auf das Erbe verzichtet hat (§§ 2346 Abs. 1 S. 1, 2348 BGB). Er wird so behandelt, als habe er zur Zeit des Erbfalles nicht mehr gelebt (§ 2346 Abs. 1 S. 2 BGB). Regelmäßig werden auch die Abkömmlinge des Verzichtenden von der Erbfolge ausgeschlossen (vgl. § 2349 BGB).
Der Erbverzicht ist ein abstraktes Verfügungsgeschäft. Ihm wird regelmäßig ein schuldrechtliches Kausalgeschäft zugrunde liegen, in dem sich der Erblasser zur Zahlung einer Abfindung und der Erbanwärter zum Abschluss des Verzichtsvertrages verpflichtet.
Auf diesen Vertrag sind die §§ 320 ff. BGB uneingeschränkt anwendbar. Kommt der Erblasser seiner Verpflichtung zur Zahlung der Abfindung nicht nach, kann der Verzichtende zurücktreten und Aufhebung des Erbverzichts (§ 346 Abs. 1 BGB) verlangen. Überwiegend wird angenommen, dass auch der dem dinglichen Erbverzicht zugrunde liegende schuldrechtliche Vertrag formpflichtig ist (§ 2348 BGB analog, arg. Zweck des Formerfordernisses; so OLG Köln ZEV 2011, 381); bei formgerechtem Abschluss des eigentlichen Erbverzichtsvertrages ist aber Heilung analog §§ 311b Abs. 1 S. 2, 518 Abs. 2 BGB möglich.
